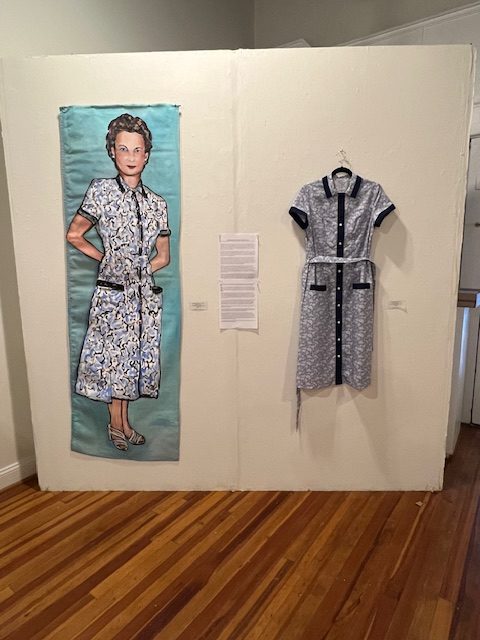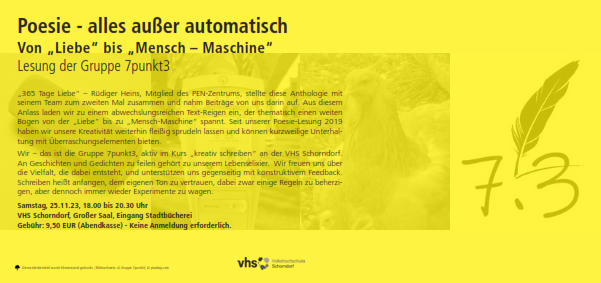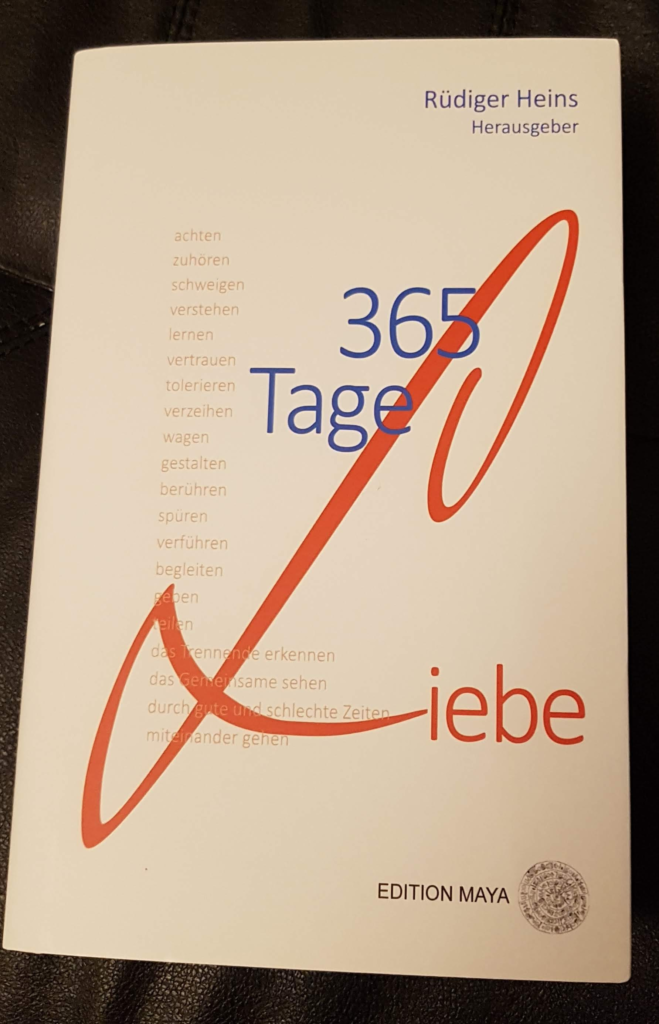“Weiheraum” gehört zu den spannendsten und eindringlichsten Büchern, die ich rezensiert habe. Geschrieben hat den Roman Klaus Marxen (geb. 1945), Jurist und Hochschullehrer, der u. a. als Richter tätig war. Angesichts der aktuellen Gefahr des Hineinschlingerns in immer mehr rechtslastige Politik erinnerte ich mich an den Protagonisten Friedrich Liedke, ein empfindsamer Staatanwalt, dessen Verstrickungen unter die Haut gehen … Ich will an dieser Stelle nichts vorwegnehmen – hier die Rezension:
Klaus Marxen lässt in seinem Roman „Weiheraum“ Zeitgeschichte in schicksalhaften Verstrickungen lebendig werden
Mit „Weiheraum“ legt Klaus Marxen einen Roman vor, der episodisch im Präsens zwei Personen in unterschiedlichen Sphären in die Katastrophe führt. Verdeutlicht werden Charaktere und deren Schicksale im zeitgeschichtlichen Kontext von 1901 bis 1950. Man ahnt, welche Wirren die Protagonisten vor heikle Fragen stellen, zumal ein Strang der Handlung in Berlin und der andere in Südmähren angesiedelt ist. Die Wege des tschechischen Mädchens Leuka und des Berliner Staatsanwalts Friedrich Liedke kreuzen sich im Wiener Landgericht. Das wird im Vorwort verraten, in dem es außerdem heißt, die Wirklichkeit tauge lediglich dazu, Spuren zu legen – dagegen müsse die Wahrheit erzeugt werden.
Der Weiheraum im Wiener Landgericht umfängt den Erzähler. Dort findet er die Namen jener, denen in diesem „Gebäude […] in nationalsozialistischer Zeit das Leben geraubt wurde“. So spornen Titel und Vorwort des Buches die Neugier an – der Weg zum tragischen Ende will nachvollzogen werden. Wo hätte es Möglichkeiten gegeben, die Geschichte in eine andere Richtung zu lenken? Was kann man davon für die Zivilcourage in heutiger Zeit ableiten? Autor Klaus Marxen, selbst Jurist – Geschichte und Philosophie hat er ebenfalls studiert –, erzeugt Wahrheit mittels ausführlicher Schilderungen, hat jedoch alle Personen, Begebenheiten und Orte frei erfunden.
Friedrich Liedke, an Kaiser Wilhelms II. Geburtstag 1901 geboren, ist eigentlich ein empfindsamer Mensch. Doch auch er will vorankommen, kein unnötiges Aufsehen erregen, das geregelte Leben nicht gefährden. Eigene Kinder sind ihm und seiner Frau Edith nicht vergönnt und der gewichtige Schritt zu einer Adoption fällt nicht gerade leicht, allerdings sind die Begleiterscheinungen für Friedrich umso qualvoller, weil er plötzlich nicht ausschließen kann, die Mutter des Kindes auf dem Gewissen zu haben. Schon lange bevor Liedkes die kleine Ingrid im Lebensborn-Heim abholen, ist dem Protagonisten Friedrich viel Zaudern auf den Leib geschrieben. Sein Vater, Konrektor an einem Realgymnasium, verkörpert ihm gegenüber eher den harten Preußen. Doch Adolf Hitler findet er anmaßend und verübelt seinem Sohn dessen Parteimitgliedschaft. Trotz stetig wiederkehrender Zweifel kann es sich der Jurist Friedrich jedoch nicht leisten, aus der Partei auszutreten und später beim Volksgerichtshof Anklagen jenseits der Konformität zu formulieren. „Was Friedrich Liedke verstört, das ist seine Feigheit.“ Dass die „Gefährdung des Staates im Krieg zu harten Abwehrmaßnahmen zwingt“, will er sich angesichts der Hinrichtungen in seiner unmittelbaren Nähe in Wien zwar beschwichtigend einreden, kann aber mit dem scharfen Wind, der in der Justiz weht, innerlich keine Übereinkunft finden. So besiegelt er 1943 schließlich das Schicksal der zum Tode verurteilten, hochschwangeren Helena Cermak, geboren 1918 in Südmähren, die ihrem schwer verletzen Bruder, einem „Staatsfeind“, geholfen hatte.
Natürlich fällt Friedrich Liedke dieser Fall immer wieder ein, denn er weiß nicht, wohin das Kind der Hingerichteten gebracht worden ist. Wie es sich gehört, wird das Geheimnis erst am Schluss gelüftet. Die locker skizzierte Auflösung wirkt nüchtern und knapp, was fast ein wenig schade ist, denn schließlich ist man an ausführlich erzählte Ereignisse und Schicksalswendungen mit fesselnden Untertönen gewöhnt. Doch mehr als der pragmatische Schluss hätte nicht in diesen Spannungsbogen gepasst, war doch der Roman nicht in erster Linie auf ein Familiendrama hin angelegt, sondern darauf, Zeitgeschichte lebendig werden zu lassen und dazu Fragen aufzuwerfen, die an Aktualität nicht verlieren.
Der Erzählstrang auf böhmischer Seite beginnt, als die Oma dieses im Gefängnis geborenen Kindes von Janek Cermak schwanger ist, der aber sein Junggesellendasein nicht aufgeben will. Mit etwas Nachhilfe kommt es dann doch zur Heirat, und letztlich hat Olga sechs Kinder von ihm großzuziehen. Als Familienvater taugt Janek Cermak jedoch nicht. Erst verdingt er sich als Heizer auf einer Lokomotive, später als Handelsvertreter für Textilien, zwischendurch leistet er sich – entsprechend seines Naturells – riskante Eskapaden. Trefflicher könnte man einen Kontrast zu der disziplinierten Familie Liedke nicht schaffen.
Olga Cermak betreibt eine Gastwirtschaft und kann sich außerdem auf ihre Eltern stützen, deren kleine Landwirtschaft ergänzend als Lebensgrundlage manche Engpässe abmildern hilft. Nach dem Ersten Weltkrieg wächst der Stolz der tschechischen Bevölkerung auf ihren Staat, dann werden Teile vom Deutschen Reich annektiert und vorbei ist es mit der friedlichen Atmosphäre. Wer dann – wie Tomas, einer der Söhne von Olga – während des Zweiten Weltkriegs gegen die herrschenden Deutschen intrigiert oder im Untergrund kämpft, wird gnadenlos verfolgt und bestraft. So wird Lenka (Helena) wegen ihrer familiären Fürsorge verraten und verurteilt.
Nach Kriegsende wird Friedrich Liedke verhaftet. Von nun an quält ihn nicht nur die Frage, ob er die Mutter seiner Adoptivtochter hat umbringen lassen, sondern wie sehr er in Verbrechen verstrickt war, die er als solche nicht erkannt oder im Anpassungsdruck verharmlost hat. Derweil umsorgt seine Schwester Elisabeth in Jüterborg das Kind und seine Frau, die 1948 stirbt. Ingrid liebt ihre Tante Lisa und hängt sehr an der Katze Jasmin. Auch Friedrich hatte als Kind ein Kätzchen bekommen, das er Jasmin nannte. Dieses Band zwischen einst und heute symbolisiert eine Verbindung zwischen Ingrid und ihrem Vater, an den sie keine Erinnerung mehr hat. Sie war zu klein, als Friedrich damals aus der Wohnung in Berlin abgeführt wurde. Ihre Mutter hatte ihr aufgetischt, der Vater sei im Krieg von den Russen verschleppt worden.
Liedke verbringt fünf Jahre im Lager Sachsenhausen, bevor er in Waldheim zum Tode verurteilt wird. Es nützt nichts, dass sein Verteidiger unterstreicht, Liedke habe lediglich in gutem Glauben gehandelt und sei als Mitläufer einzustufen. Marxen knüpft mit seinem Roman an tatsächliche Geschehnisse an und führt hier vor Augen, dass in der jungen DDR noch eine tödliche Justizmaschinerie wirksam war. „Unrecht im Gewand des Rechts“ – diese Worte gebraucht der Klappentext des Buches für die Praxis im Volksgerichtshof wie in den Waldheimer Prozessen. Natürlich handelt es sich nicht nur, wie eingangs komprimierend vorausgeschickt, um die Schicksalslinien zweier Personen, sondern immer ist mindestens das „System Familie“ betroffen, wenn das „System Staat“ die Entscheidung zwischen Recht und Unrechtsempfinden zu einem unlösbaren Dilemma werden lässt. Ja, ganze Generationen sind von dem Phänomen gezeichnet, sich mit etwas arrangiert zu haben, für das man nur auf Verständnis bei den unter anderen Verhältnissen Nachgeborenen hoffen kann. Gerade weil in beiden Handlungssträngen die Charaktere glaubwürdig und die Ereignisse im Grundansatz unspektakulär sind, zeigt der Roman besonders schmerzlich die Unbezwingbarkeit von Zwickmühlen in totalitären Systemen, in denen die Rechtspflege bekanntlich die herrschende Ideologie legitimieren soll.
Interessant ist der Aufbau des Romans, der sich in drei Teile gliedert, von Kapitel zu Kapitel jeweils die Perspektive wechselt (was der Wechsel zur Kursivschrift und zurück unterstreicht) und mit Rückblenden arbeitet, die nichts in die Ferne rücken lassen. Das Gefühl, immer unmittelbar dabei zu sein, reißt nicht ab. Und obwohl einerseits die Genauigkeit des ehemaligen Gerichtsberichterstatters Marxen manchmal an Geduldsproben erinnert, befördert die Kürze der Kapitel den Stoff flott und abwechslungsreich. Eine beeindruckende Lektüre.
Klaus Marxen: Weiheraum. Roman.
Bouvier Verlag, Bonn 2015.
260 Seiten, 19,99 EUR.
ISBN-13: 9783416033893
Tags: Karriere, Marxen Klaus, NS-System, Roman, Weiheraum, Zeitgeschichte